Kapitel 11
Rechtsfragen
Recht für Videoamateure
Videos herzustellen hat immer mit Menschen zu tun. Es sei denn, du beschränkst deine Dreharbeiten auf Knete-Männchen und Strich-Zeichnungen. Bei jedem Video aus dem Urlaub, bei Veranstaltungen in der Firma oder im Kindergarten bildest du mit der Kamera Menschen ab, die zu sehen und/oder zu hören sind. Später, das Video ist fertig geschnitten und auf deinen YouTube-Kanal geladen, können Oma und Opa und noch ein paar Tausend Verwandte, Bekannte und Freunde im Internet erleben, wie es im Skiurlaub von der heißen Piste in die noch heißere Bar und dort hoch herging. Jeden Abend lief die Kamera in der gemütlichen Berghütte, viele Momente des turbulenten Winterurlaubs hast du in deinem Urlaubsvideo verarbeitet: die fesche Bedienung, die Maß um Maß Bier mit einem Zwinkern servierte, Aufnahmen von der hoteleigenen Postkarte. Das Ganze musikalisch begleitet von einer Audio-CD der Schrummelsberger Musikanten, die gab es beim Tanztee günstig zu erwerben. Ein Video, das bei Freunden und Bekannten viel Zustimmung fand. Bis ein paar Tage später eine weniger nette E-Mail die Winterurlaubsvideofreude deutlich eintrübte. Der Absender, Herr XYZ, Zimmernachbar aus dem Winterurlaub. Die nette Familie, die Kinder 10 und 12 Jahre alt, begeisterte Wintersportler und täglich auf der Piste, waren mehrfach vor die Kamera »gelaufen«. Natürlich hast du sie vor den mutigen Abfahrten mit der Kamera festgehalten, groß und mit O-Ton. Als Dank für das Gespräch vor der Kamera bekam Familie XYZ den YouTube-Link zum fertigen Video und der Videohersteller den wenig freundlichen Hinweis, dass mit der Veröffentlichung des Videos Verstöße in allen möglichen Rechtsgebieten verbunden sind.
Blitzartig kommt dir der Gedanke: Aber das ist doch alles nur ein Privat-Video. Das Ergebnis des ausgiebigen Gesprächs mit dem E-Mail-Absender, er outet sich als Rechtsanwalt, ist überaus erhellend – für jeden Videomacher.
Betroffene Rechtsgebiete
Vor Hinweisen, Erläuterungen und Empfehlungen in diesem Buch muss klar sein, sie alle stellen keine Form der Rechtsberatung dar. Das ist wie bei Tante Erna, die mir bei Erkältungskrankheiten ihre alternativlosen Hausmittel empfiehlt oder gar aufdrängelt. Denn diese »Ratschläge« sind verboten, wenn sie in irgendeiner Form entgeltlich gegeben werden oder per Gesetz ausschließlich bestimmten Berufsgruppen vorbehalten sind. Selbst wenn Ratgebende gegenüber Ratsuchenden eine besondere Vertrauensstellung besitzen, können Empfehlungen und Ratschläge Haftungsfragen gegenüber dem Ratsuchenden nach sich ziehen.
Was für Tante Ernas Beratung bei Erkältungskrankheiten gilt, ist auch zutreffend bei der Beratung zu Rechtsfragen auf diesen Seiten. Rechtsverbindlich beraten und Auskünfte erteilen dürfen Anwälte, Erfahrungen austauschen hingegen kann ich mit Gleichgesinnten, in Internetforen, im Videoklub usw.
Als Videomacher rechtssicher zu agieren, ist vor allem schwierig, weil es nicht das eine Videorecht gibt. Je nachdem, was du mit der Kamera (egal ob für Video- oder Fotoaufnahmen) einfängst und was danach mit den gespeicherten Daten passiert, immer bewegst du dich in verschiedenen und oft gleichzeitig in mehreren Rechtsgebieten.
Aspekte aus dem Persönlichkeitsrecht
Jeder Mensch hat das Recht, zu entscheiden, ob Film- und Videoaufnahmen von ihm angefertigt werden. Dieses Recht am eigenen Bild regeln die Paragrafen 22 und 23 im Kunsturhebergesetz [24].
Mit Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Jahr 2018 konnte so mancher in (s)einem Verein bereits Erfahrungen zum Umgang sowie zur Veröffentlichung von Daten sammeln. Personenbezogene Daten entstehen mit der Smartphone-Kamera beim Aufnehmen von Personen. Ob dabei deren Gesicht erkennbar ist oder ein anderes markantes Merkmal Rückschlüsse auf die Identität zulässt, ist gleichgültig.
Allein und ausschließlich die Verwendung dieser personenbezogenen Aufnahmen (Daten) für familiäre und private Zwecke ist gestattet, sofern diese Aufnahmen nicht verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.
Den Videoaufnahmen der familiären Kaffeetafel zu Omas 100. Geburtstag steht nichts im Weg – bis der Bürgermeister, einen Präsentkorb im Arm, zum Jubiläum erscheint. Wird der oberste Vertreter der Stadt vor der Aufnahme gefragt und stimmt zu, kann gedreht werden.
Die Zustimmungspflicht entfällt, wenn Aufnahmen von Versammlungen oder Aufzügen entstehen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben, etwa bei Festumzug anlässlich des XXX. Stadtjubiläums.
Befreit von Sorgen bist du auch, wenn die abgebildete Person sich gegen einen finanziellen Ausgleich zur Aufnahme bereit erklärt hat.
Bei der Aufnahme von Kindern unter 18 Jahren geht ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten ebenfalls nichts mit der Kamera.
Personen, die »zufällig« ins Bild geraten, während gerade Videoaufnahmen entstehen, etwa in der Stadt, in einem Park, auf einem Schulhof, solltest du besser über die Dreharbeiten informieren. Mit der Erklärung, dass sie wenig oder überhaupt nicht erkennbar sind, kannst du meistens Ungemach und Streit vermeiden.
Einen Abbildungsbonus hast du beim Drehen von »Promis«. Dazu zählen Menschen, deren öffentliche Präsenz offensichtlich ist, etwa Politiker, Sportler, Künstler, Wissenschaftler.
Präzise Vorgaben sind dem Gesetz in mancher Hinsicht nicht zu entnehmen. So bleibt in konkreten Zweifelsfällen nur das Nachfragen: Darf die Kamera jetzt laufen?
Ob der zu Omas 100. Geburtstag gratulierende Bürgermeister – seit der gewonnenen Kommunalwahl vor 6 Monaten ein politischer Quereinsteiger und sehr talentiert – in die Kategorie prominenter Politiker fällt und damit gedreht werden darf, solltest du juristisch lieber nicht ausfechten. Gehe auf ihn zu, mache ihn spontan und mit freundlichen Worten zum Protagonisten des Videos – und er wird dir die Dreherlaubnis erteilen.
Sind sämtliche Zustimmungen eingeholt, darf die Smartphone-Kamera aufzeichnen und bald steht die nächste Frage im Raum: Ist die Vorführung des fertigen Videos in ausschließlich (privatem) familiärem Kreis geplant? Oder soll das Video ein größeres Publikum erfreuen?
Bei der Vorführung eines Videos im engen Kreis, dazu zählen neben der Familie auch Freunde und enge Bekannte, greift die DSGVO nicht. Jede Vorführung über diesen sehr eng begrenzten Kreis hinaus ist öffentlich und bedarf der Zustimmung der abgebildeten und nicht unkenntlich gemachten Personen. Mit dem Schutz der Persönlichkeitsrechte haben wir also auch nach dem Videodreh zu tun. Die Zustimmung der abgebildeten Personen sollte daher unbedingt auch die spätere Verwendung des Videos einschließen.
Öffentlich sind Videoaufnahmen auch in der Cloud, selbst wenn der Zugang Personen ermöglicht wird, die zu dem sehr engen Kreis der Familie, Freunde, Bekannte zu zählen sind. Gleiches gilt für die Veröffentlichung in sozialen Medien bei Twitter, TikTok, Facebook und natürlich YouTube und anderen Videoportalen.
Ein Blick in das Urheberrecht
Das Urheberrecht schützt Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, wozu auch Videos gehören.
Im Falle der Herstellung eines Videos bist du der Urheber dieses Videos. Dabei reicht es nicht, die Idee für (ein ganz tolles) Video zu haben und dieses Video später einmal herstellen zu wollen.
Erst wenn das Video existiert, man sagt auch, dass es ein Werk ist, bist du Urheber und besitzt automatisch und genau an diesem Werk das Urheberrecht.
Du musst das Urheberrecht an deinem Werk nicht irgendwo anmelden oder eintragen lassen. Es ist mit der Schaffung des Videos entstanden und dann einfach da. Es ist deshalb da, weil ja auch das Video da ist. Auf dem PC oder einem Stick oder hochgeladen auf YouTube.
Das Urheberrecht kannst du nicht verkaufen, verschenken oder sonst irgendwie »loswerden«.
Als Urheber des Werkes kannst du bestimmen, ob und wie das Werk genutzt werden darf. Du bestimmst über die Verwertung des Werkes, da du als Urheber auch über die Verwertungsrechte verfügst. Die Verwertung kannst du selber wahrnehmen oder sie anderen übertragen. Mit der Verwertung kann auch eine finanzielle Gewinnabsicht verbunden sein.
So wie für dein Video (Werk) gelten die Urheberrechte und die Wahrnehmung der Nutzungsrechte auch für Werke anderer Urheber. Dazu gehören Fotos, Bilder, Musik, grafische Entwürfe, Videos, Bücher, Tonaufnahmen, Geräusche, Software und viele andere Werke im Sinne des Urheberrechts [25].
Bei der Herstellung eines Videos kommst du häufig mit den Werken anderer Urheber und deren Nutzungsrechten in Berührung. Dazu zählt die Verwendung fremder Fotos, Sprach- oder Musik-CDs, Geräusche, Videos usw.
So kann festgelegt sein, dass die Verwendung eines Bildes nur gegen Zahlung einer Gebühr genehmigt ist. Ebenso können Nutzungsrechte die unentgeltliche Verwendung von Musik festlegen.
Auf der Postkarte (ein Werk) des Winterhotels sind Fotos, an denen ein Mensch Urheberrechte und ein Mensch oder eine Gesellschaft Nutzungsrechte besitzen. Vor der Verwendung der Bilder dieser Postkarte musst du den Inhaber der Nutzungsrechte ausfindig machen und erfragen, ob die Nutzungsrechte die Verwendung der Postkarte in deinem Video erlauben.
Sind in dieser Hinsicht Probleme absehbar, kann sich – bei guter Planung – das Drehen oder Fotografieren des Hotels von außen mit dem eigenen Smartphone durchaus lohnen. Es spart viel Geld und/oder Ärger, wenn du bedenkst, dass Außenaufnahmen, also von der Straße, ohne Probleme verwendet werden dürfen.
Im Gegensatz dazu ist der Einsatz von Musik deutlich komplizierter. Es ist klar, dass an einer Musik Urheberrechte bestehen. Für die Verwendung eines Musikwerks in deinem Video brauchst du eine Genehmigung, die der Urheber auch versagen kann. Die Zustimmung solltest du vom Urheber schriftlich bestätigen lassen.
Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Mit dem Tod des Urhebers geht es auf die Erben über. Die Frist von 70 Jahren gilt für Musik, Fotos, Bilder und Gemälde, grafische Darstellungen und andere Werke, die unter das Urheberrechtsgesetz fallen.
Lizenzrecht und GEMA
Verwendest du für die musikalische Begleitung deines Videos eine Musik-CD, berührt das neben dem Urheberrecht zusätzlich Nutzungsrechte, die durch Aufnahme und Audio-CD-Herstellung entstanden sind.
Diese Nutzungsrechte auszuüben und zu kontrollieren, übertragen Urheber Verwertungsgesellschaften. In Deutschland lassen etwa 70.000 Urheber die Nutzungsrechte an ihren (Musik-)Werken durch die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) verwalten.
Enthält dein Video Musik von einem durch die GEMA vertretenen Urheber, wird die Gesellschaft automatisch dein Vertragspartner. Per Gebührenordnung lassen sich die zu erwartenden Kosten der Musiknutzung in deinem Video ermitteln.
Lizenzen für schöpferisches Gemeingut – CC
Weniger spektakulär ist die bereits im Kapitel Musik aus dem Netz aufgezeigte Möglichkeit, Musik aus Quellen zu beziehen, die nicht unter den Standardschutz »alle Rechte vorbehalten« fallen.
Diese geschützten Inhalte unterliegen Creative-Commons-Lizenzen (CC) [26]. CC ist eine Non-Profit-Organisation, die Urhebern Hilfestellung für die Freigabe geschützter Werke in Form vorgefertigter Lizenzverträge anbietet. Derzeit stehen sechs Lizenzverträge zur Verfügung, mit denen Urheber unterschiedliche Freiheiten für die geschützten Inhalte einräumen. Die dabei geregelten Rechte beziehen sich auf:
- Namensnennung
Der Name des Urhebers muss genannt werden.
- Kommerzielle Verwendung
Die kommerzielle Verwendung des Werkes ist nicht erlaubt.
- Erlaubnis der Veränderung von Inhalten
Die Veränderung des Werkes ist nicht gestattet.
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen
- Nach der Veränderung muss das Werk unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden.
Aus diesen vier Modulen ergibt sich durch die Kombination die schon genannte Auswahl von insgesamt sechs verschiedenen CC-Lizenzen, die dem Rechteinhaber in offizieller deutscher Übersetzung derzeit in der Version 4.0 zur Verfügung stehen.
Ein sehr genaues Studium der Lizenzbedingungen ist dennoch dringend empfohlen, da die freie oder kostengünstige Verwendung der Musik auf bestimmte Ereignisse beschränkt ist. So kann die private und nicht kommerzielle Verwendung frei von Gebühren sein, die Verwendung der Musik in einem kommerziellen Umfeld – Imagevideo eines Unternehmens, einer wissenschaftlichen Institution oder Behörde – dagegen kostenpflichtig.

Namensnennung

Namensnennung, Weitergabe gleiche Lizenzbedingung
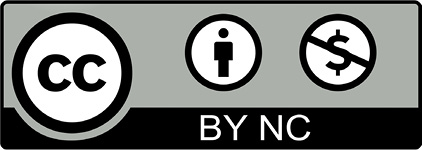
Namensnennung, nicht kommerziell

Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe gleiche Lizenzbedingung
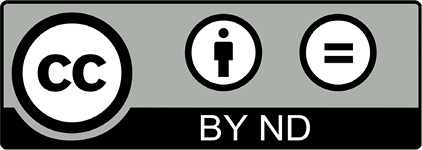
Namensnennung, keine Bearbeitung

Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung
Die nicht genehmigte Verwendung der Audio-CD der Schrummelsberger Musikanten in deinem auf YouTube veröffentlichten Video ist damit eine Urheberrechtsverletzung sowie eine Verletzung der Nutzungsrechte.
Aufnahmen mit Kindern und Jugendlichen
Mit der Vollendung des 14. Lebensjahres müssen Eltern und Jugendliche den Aufnahmen zustimmen. Für jüngere Kinder ist die Einverständniserklärung der Eltern erforderlich, aber auch ausreichend. Ein Dreh der Nachbarskinder auf der Schneepiste ohne ausdrückliche Zustimmung der Eltern – also keine gute Idee. Verletzt werden in diesem Fall Persönlichkeitsrechte des Kindes sowie der Schutz von personenbezogenen Daten. Ohne ausdrückliche Zustimmung ist der Dreh auf der Piste ebenso verboten wie ein Dreh im Kindergarten. Es sei denn, mit den Erziehungsberechtigten der »Kleinen« gibt es präzise Absprachen zu den Aufnahmen und zur späteren Verwendung des Materials.
Trotz der restriktiven Regeln der DSGVO gibt es Eltern, die Interesse haben, auf Videoaufnahmen auch ihre Kinder zu sehen und im Kreis ausgewählter Zuschauer zu zeigen.
Im Meer sozialer Medien
Bevor sich soziale Medien vom Tummel- und Tauschplatz privater Äußerungen zum medial hochgerüsteten Kampfgebiet im öffentlich geführten Meinungsdiskurs wandelten, beschränkte sich die Weitergabe von Videoproduktionen auf selbst gebrannte DVDs. Deren Herstellungs- und Vervielfältigungsaufwand engte schon aus ökonomischen Gründen die Reichweite – also die Menge der Menschen, die durch ein Medium erreicht werden – deutlich ein. Kein vernünftiger Mensch hätte in seinem Wohnviertel per Video-DVD bekannt gemacht, dass der Filius ein Rotkäppchenkostüm für den Kinderfasching bevorzugt. Die nicht unbegründeten Bedenken, dass »besorgte« Nachbarn diese Verhalten Jahre später äußerst eigenwillig auslegen könnten, ist verständlich und in keiner Weise lebensfremd.
Weshalb also Bilder und Videos aus dem familiären oder zumindest privaten Umfeld in die ganze Welt »posten«? Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass ständige und weltweite Präsens von jedermann wie ein Gottesurteil über den Segnungen der Medienwelt schwebt.
Ganz im Sinne der Bekämpfung von Missbrauchsmöglichkeiten – und das gilt besonders für Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen – ist (Selbst-)Beschränkung nicht nur das Ziel gesetzlicher Regelungen, sondern technisch sehr wohl möglich. Damit ist kein Zurück zur »Selbstgebrannten« (DVD) gemeint, sondern die bewusste Auswahl und Verwendung der medienfähigen Portale. Social-Media-Kanäle, in denen sich die private Nutzung von Inhalten nicht auf einfache Weise einstellen lässt, solltest du so lange meiden, bis sicher ist, dass ausschließlich von dir autorisierte Personen auf deine Videos zugreifen können.
Niemand wird auf ein erfrischendes Bad im Meer verzichten, weil die Gefahr des Ertrinkens besteht. Vernünftiger ist es, die Tücken des Meeres kennenzulernen, nicht ins unbekannte Wasser zu springen, gut vorbereitet zu sein und am besten auch noch Schwimmen zu erlernen. Im Meer der sozialen Medien gelten ähnliche Verhaltensregeln, um möglichen Schaden vorzubeugen und zu verhindern.
Einem Video über den Kinderfasching und einem männlichen Rotkäppchen kann Jahre später der Betroffene, inzwischen selber Vater von zwei Kindern, Erheiterndes wie Erhellendes abgewinnen und für eigene, pädagogisch kluge Entscheidungen nutzen.
Nutze daher die Medienportale nur dann zur Ausdehnung der Reichweite, wenn du ganz sicher bist, dass die halbe Welt Gast in deinem Privatleben sein soll.
Anders ist die Situation beim Verein, Unternehmen oder bei einer wissenschaftlichen Einrichtung. Da kannst du mit einem Mausklick die Welt medial erobern – oder es wenigstens versuchen.
YouTuber & Co
Dass du als aktiver YouTuber oder Nutzer anderer sozialer Netzwerke den gültigen Rechtsnormen Videos betreffend unterliegst, beschreibt ausführlich und auf aktuellem Stand [28].
- Für Videos, die du hergestellt hast, besitzt du die Urheberrechte.
- Für die Musikverwendung musst du eine Genehmigung des Urhebers der Musik haben. Zusätzlich kann die Verwendung von Musik gegenüber dem Inhaber der Nutzungsrechte der Musik kostenpflichtig sein.
- Musik, die unter die Creative-Common-(CC-)Lizenzierung (Seite 203) fällt, darf häufig, aber nicht immer, kostenfrei verwendet werden. Konkrete Aussagen dazu findest du als Lizenzhinweis zu dem entsprechenden Musikwerk.
- Jede Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material, Musik, Videos, Bilder und grafische Darstellungen, berührt Urheber- und die Nutzungsrechte, bedarf der Genehmigung und ist häufig kostenpflichtig.
Selbst die Verwendung solchen Materials als Zitat oder »unwesentlichem Beiwerk« – ein Bild im Hintergrund, eine Musik aus einem Radio, ein Film im TV-Gerät – kann Probleme bereiten. Sicherheit schafft nur eine verbindliche rechtliche Abklärung.
- Die Verwendung eines Videos im Internet durch Einbetten ist grundsätzlich gestattet, setzt aber immer die Zustimmung des Inhabers der Nutzungsrechte voraus.
Auf die gleiche Weise sind auch deine Videos geschützt. Das »Embedden« in andere Internetseiten bedarf deiner Zustimmung.
Der Check vor dem Dreh
Ob ein Familienvideo entstehen soll, der Verein für neue Mitglieder wirbt oder (m)ein Unternehmen mit einem Imagevideo Nutznießer meiner medialen Fertigkeiten sein wird, bevor der erste Videoclip aufgezeichnet wird, sind immer eine Reihe von rechtlich bedeutenden Fragen zu bedenken. Eine sehr gute Übersicht in Form von Checklisten für viele Rechtsfragen bei Videoproduktionen findet sich in [22]. Den Blick für die Vielfalt der Rechtsfragen bei der Herstellung von Videos kann diese Zusammenstellung schärfen, nicht aber die anwaltliche Beratung ersetzen.